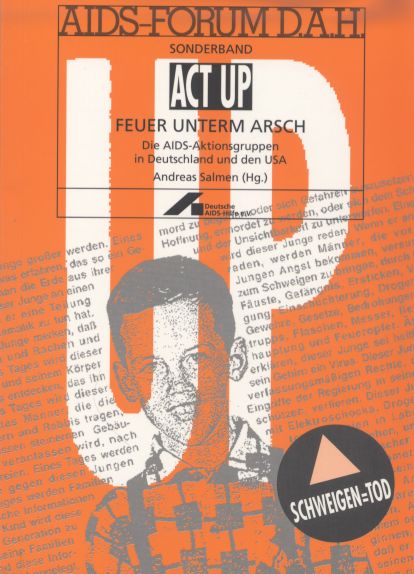Unsere Geschichte – Geschichten vom alten und vom neuen Aids, Geschichten vom Leben mit HIV.
Heute: Nikolaus Michael (Teil 3): Schmunzeln, Quengeln, Hilferufe
Johannes – mein inzwischen liebgewonnener Freund mit den schwarzen Locken wurde von Monat zu Monat immer schwächer und hinfälliger. Wenn wir beide alleine waren, erzählte er mir von seinen Depressionen und ließ sich nicht von seiner Meinung abbringen, dass wir alle in Kürze sterben müssten. Da ich immer der Ansicht bin, dass es so etwas wie Wunder gibt, widersprach ich ihm jedes Mal und versuchte ihm Mut zu machen so gut es ging. Er schlief oft bei mir oder ich bei ihm – wir hielten uns aneinander fest wie Ertrinkende – er konnte nicht mehr alleine leben – irgendwie verstand ich das auch bei seinen Ängsten. Er lebte noch 3 Jahre und verbrachte die letzten Monate seines Lebens auf dem Hausboot einer Freundin im Lauenburger Raum, so dass wir uns nur noch selten sehen konnten. Aber er liebte die Natur so sehr und war ihr dort nahe – und – er musste sich nicht täglich mit dem fortwährenden Sterben um uns herum auseinandersetzen – er konnte es einfach nicht mehr – hatte keine Kraft mehr.
Beerdigungen waren zu dieser Zeit en Vogue – fast wöchentlich – manchmal täglich ging ich zu einer Trauerfeier, die in meinem Freundeskreis anfielen. Da es meistens junge Menschen betraf, die wussten, dass sie nicht mehr lange zu leben hatten und entsprechend vorgeplant hatten, handelte es sich immer um kleine oder größere Inszenierungen – manche außergewöhnlich und eher an Feste, denn an Trauerfeiern erinnernd. Meistens wurde – im Gegensatz zu den Beerdigungen von Großeltern und Verwandten, die ich erlebt hatte – die Lieblingsmusik der betroffenen Freunde in der Trauerhalle aufgelegt – manche baten darum, dass wir alle in weißer Kleidung mit einer weißen Rose zur Feier kamen……
Einer unserer Freunde, der auch beim Caféprojekt kurz mitgemacht hatte, er nannte sich Napoleon, besorgte sich noch zu Lebzeiten seinen Sarg, den er in seiner Wohnung aufbahrte – er kokettierte allerdings sehr oft – mir fast zu oft – mit seinem in Kürze zu erwartenden Ableben – lebte aber glücklicherweise noch weitere zehn Jahre. Irgendwie verstand ich ihn – und dann wieder auch nicht. Aber jeder hat das Recht, seine eigene Trauer seiner eigenen Art gemäß zu leben – und er war halt so.
Heinz war der Älteste in unserer Gruppe aus der Nachodstraße in Schöneberg – er musste damals bereits Ende 40 gewesen sein – sah jedoch durch seine weißen Haare schon etwas älter und reifer aus. Er war ein freundlicher Mann – Typ väterlicher Freund, der unablässig seinen kranken Zustand beklagte und es verstand, uns alle gleichzeitig auf Trab zu halten. Er hatte bereits beim bekannt werden seiner Infektion durch eine Serie von Vorerkrankungen bei den Behörden alles beantragt, was damals nur möglich war. Er war durch ein Notrufsystem ständig mit dem Deutschen Roten Kreuz verbunden und hatte als erster einen komplett funktionierenden Hauspflegedienst im Einsatz, der täglich seine Wohnung versorgte und auch für seine Pflege zuständig war. Den Schwerbehindertenausweis hatte er auch bereits seit Jahren erhalten, sowie die Übernahme von Telefon und Fernsehgebühren. Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln samt Begleitperson waren auch genehmigt – seine Wohnung hatte er mit Behörden- und Krankenkassenhilfe längst rollstuhlgerecht umbauen lassen. Da er jedoch gerne quengelte, hielt es kein Hauspflegedienst lange bei ihm aus – die neuen Pfleger und Pflegerinnen gaben sich fast täglich wechselnd die Klinke in die Hand. Interimsmäßig waren wir es bereits gewöhnt, bei ihm einspringen zu müssen – hatte er mal alle Pflege am Tage gehabt und ihm fiel dennoch meist etwas ein – musste sein Fernseher herhalten uns hinzubitten, denn da fiel die Programmierung immer bei Stromausfall aus – er konnte dann keine Programme mehr speichern. Wenn er nicht fernsehen konnte, hielt er uns per Telefonkommandos in Atem und so fuhr einer von uns meist schnell mal hin und stellte ihm seine Programme wieder so ein, dass er schauen konnte. Mehr als einer von uns hatte den heimlichen Verdacht, dass er bei Langeweile auch mal an der Sicherung drehte – weil er wusste, dass er dann wieder einen Grund hatte, uns schnell wieder herbeizurufen. Wir registrierten das jedoch mit einem Schmunzeln, denn trotz seiner ständigen Quengeleien hatten wir ihn recht gern gehabt.
Unvergessen sind seine Hilferufe – er wäre gerade heute sterbenskrank und bräuchte sofortige Hilfe. Eines Tages – so ein Hilferuf hatte mich mal wieder tagsüber im Büro erreicht und ich konnte gerade nicht sofort weg – von meinem Arbeitsplatz aus benötigte ich 15 Minuten – er hatte mir gerade mit ersterbender Stimme erklärt, dass es nun bald soweit sei und er sich überhaupt nicht mehr bewegen könne. Eine halbe Stunde später musste ich dienstlich außer Haus und sah Heinz am U-Bahnhof Spichernstraße im Ausgehanzug mit flottem Hut auf dem Kopf beschwingten Schrittes auf den U-Bahnhofeingang zusteuern. Ich glaubte erst mal an eine Fata Morgana – bis seine vorher am Telefon fast erloschene Stimme nun wieder erstaunlich kräftig wissen ließ, dass es ihm erstaunlicherweise danach wieder einigermaßen gegangen wäre und er nun zu einer Verabredung gehen könne. Nach diesem Vorfall hatte ich Mühe, bei neuerlichen Hilferufen ernst zu bleiben – bin aber dennoch meistens geeilt, da es ja auch mal tatsächlich nötig sein konnte. Heinz lebte noch 4 Jahre und ich habe, als er tatsächlich auf dem Sterbebett lag, die Lage zum ersten Mal falsch eingeschätzt. Da er in den Jahren zuvor so oft sein zu erwartendes Ableben erstaunlich real telefonisch beschrieben hatte, übersah ich dann die Zeichen, dass er nun wirklich schwächer wurde und war total bestürzt, als er dann tatsächlich endgültig eingeschlafen war. Ich werde ihn ganz sicher nie vergessen und habe ihm natürlich gerne die kleinen Mogeleien verziehen. Er hatte übrigens schon Jahre vor seinem Tode ein Grab auf dem Friedhof Westend gekauft und saß des öfteren dort auf einer Bank und trauerte über seine Lage und das konnte ich dann tatsächlich auch gut verstehen. Er ist der einzige aus meiner Gruppe, der eine Videoaufzeichnung für seine Familie hinterlassen hatte – ich habe sie damals für ihn realisiert und bis heute noch aufgehoben, da es doch ein sehr lebendige Erinnerung an ihn ist – wenn ich auch die Aufzeichnung zu diesem Zeitpunkt doch als verfrüht empfand – er lebte danach glücklicherweise noch einige Jahre.
Reinhard lernte ich im Café Positiv kennen – ein schlanker, blonder, gut aussehender junger Mann, der – wie ich – ebenfalls einen Bobtail besaß. Allerdings war sein Rüde im Gegensatz zu meiner Hündin ein Riese – er wog um die 80 Kilo hatte aber glücklicherweise das liebenswerte Gemüt eines Kleinkindes – ein seltsamer Kontrast. Über die Hunde fanden wir dann auch immer häufiger Gelegenheit, uns zu treffen, so dass wir auch gelegentlich mal mit den Hunden auf Reisen gingen. Reinhard hatte eine schwermütige Art – ich denke, dass das nicht ausschließlich mit seiner Infektion zu tun hatte. Sein Hauptproblem war – wie bei vielen von uns – dass er nur schlecht zuhause alleine sein konnte. Unsere Treffen waren auch oft durch unsere Arbeit als Betreiber des Café Positiv bedingt – im Laufe der Zeit jedoch wurde daraus eine nette Freundschaft, die sich auch weiter vertiefte, als ich für meinen Teil das Betreiberkollektiv verlassen hatte, weil mir die Begleitung von sterbenden Freunden doch zu diesem Zeitpunkt wichtiger schien. Er war von Beruf Krankenpfleger und hatte sich in den letzten Jahren mit einem Job als Altenpfleger bei einer Pflegestation noch etwas zu seiner Rente hinzuverdient. Manchmal nahm er mich auf seiner Tour mit und ich bewunderte seine liebevolle und fachlich ausgezeichnete Art, mit seinen Patienten umzugehen. Später haben wir uns oft bei der Betreuung von Freunden abgewechselt, wenn diese bettlägerig wurden oder ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten.
Nach ungefähr 5 Jahren unserer gemeinsamen Arbeit wurde Reinhard zusehends depressiver, wobei ein Grund war, dass sein Hund an Nierenkrebs erkrankte und er leider auch mit bester tierärztlicher Hilfe nicht zu retten war. Wir waren damals oft zusammen in der Charité, wo es eine ausgezeichnete Veterinärmedizinische Ambulanz gab. Hinzu kamen Probleme mit einer unerwiderten Liebesbeziehung, was ihm zusätzlich sehr zu schaffen machte. Er mietete dann für ein Jahr mit einem Bekannten zusammen eine Wohnung in Valencia/Spanien – wo er aber dann leider nur zweimal für kurze Zeit war – er fand nirgendwo so richtig Ruhe. Jedenfalls – ich war im März 1996 gerade nach Spanien gezogen, als mich die Nachricht erreichte, dass Reinhard sich umgebracht hatte. Kurz zuvor bekam ich von Reinhard einen Brief, wo er mir schrieb, dass er einen Selbstmordversuch mit Tabletten unternommen habe, er aber noch rechtzeitig gefunden wurde.
Später erfuhr ich dann, dass der Arzt im Krankenhaus, wo er nach dem Suizidversuch eingeliefert worden war nach wenigen Tagen mit seiner Entlassung einverstanden war und er lediglich das Versprechen abgeben musste, es nicht noch einmal zu versuchen. Reinhard fuhr direkt vom Urbankrankenhaus in Kreuzberg mit der U-Bahn Linie 6 nach Hause – wo er sich dann am U-Bahnhof Flughafen Tempelhof vor eine einfahrende U-Bahn stürzte. Seinen letzten Brief habe ich bis heute aufgehoben und bis heute habe ich noch das Gefühl versagt zu haben – auch wenn wir vor meiner Abreise nach Spanien einige Gespräche hatten, wo ich ihm gesagt hatte, wie sehr ich mich freuen würde, wenn er baldmöglichst mit nach Spanien kommen könne – Platz genug wäre für ihn da gewesen. Es sollte nicht sein.
Copyright dieses Textes: Nikolaus Michael
Vielen Dank an Niko für sein Einverständnis, diesen Text hier wiederzugeben!
Nikos Geschichte(n):
1. Die ‚Totenbank‘
2. Stress im Krankenhaus
3. Schmunzeln, Quengeln, Hilferufe
4. Drei Engel