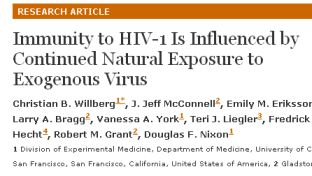Lässt sich das HIV-Infektionsrisiko durch die Partnerwahl senken? Oder durch eine wirksame anti-HIV-Therapie? Ein Blick in Zahlen und Studien und eine sachliche Debatte über neue Wege der HIV-Prävention hilft sicher mehr als Aufgeregtheiten à la Spahn.
Dass die Zahl der HIV-Neu-Infektionen möglichst gering gehalten werden sollte, ist unstrittig. Über den Weg, dieses Ziel zu erreichen, hingegen gibt es große Meinungsunterschiede – bis hin zu Äußerungen, die darauf zielen, Positiven einseitig die Verantwortung zu zu weisen, oder gar Vorschlägen, die de facto versuchen mit dem Strafrecht Prävention zu betreiben.
Diese Aufgeregtheiten führen sicherlich nicht zu einer seriösen Debatte, die sie die jüngste Resolution des 120. Positiventreffens einforderte. Ein Blick in einige Zahlen und Studien hingegen vielleicht schon. Zahlen, die einige Informationen liefern können
– wo Infektionen stattfinden,
– ob es hilft, seinen Sexpartner nach dem HIV-Status zu suchen (Serosorting), oder
– wie sich eine Kombitherapie auf die Infektiosität auswirkt.
Wo finden Neu-Infektionen statt?
Wenn diskutiert wird, wie auf steigende Zahlen an HIV- Neudiagnosen zu reagieren sei, lohnt neben einer differenzierten Betrachtung nach Regionen auch ein Blick darauf, in welchem Kontext denn Infektionen stattfinden: Ein wesentlicher Teil (etwa 25%) findet in Beziehungen statt, bei Heteros sogar etwa 50% 1).
Ein weiterer großer Teil findet statt durch Menschen, die selbst erst kurze Zeit HIV-infiziert sind (und dies u.U. nicht einmal selbst wissen): eine kanadische Studie kam zu dem Ergebnis, dass 50% der HIV-Übertragungen durch Menschen mit primärer HIV-Infektion stattfinden. Eine US-Studie geht sogar von 70% aus, eine weitere US-Studie ergab, dass 77% der jungen HIV-infizierten US-Großstadt-Schwulen sich ihrer HIV-Infektion nicht bewusst sind.
Der Anteil von (HIV-Übertragungen durch) Positive mit chronischer unbehandelter oder behandelter HIV- Infektion hingegen lag in der kanadischen Studie bei 15% bzw. 12%.
Der hohe Prozentsatz bei Menschen mit primärer HIV- Infektion trat dabei in allen Betroffenengruppen (homo, hetero, iv-Drogengebrauch) auf, und unabhängig von der Zahl der Sexualpartner. Einer der Gründe könnte darin liegen, dass diese ungetestet HIV-Positiven scheinbar besonders häufig zu unsafen Sexpraktiken tendieren, wie eine CDC-Studie zeigt.
Die hohe Infektiosität in den ersten Monaten der HIV- Infektion könnte ein sinnvoller Ansatz für Präventions- Maßnahmen sein – viel eher als ziellose Präventions- Kampagnen à la „… geht jeden an“ oder blinde Schuldzuweisungen an Positive.
Schützt Serosorting? oder – die vermeintlich ‚Negativen‘ …
Eine beliebte Strategie, Risiken (vermeintlich?) besser zu managen ist das Serosorting – HIV-Positive suchen sich als Sexpartner möglichst Positive, Negative suchen sich möglichst Negative.
Allerdings: HIV-Negative (oder besser: Personen, die selbst davon ausgehen, derzeit HIV-negativ zu sein) erhöhen ihr Risiko sich mit HIV zu infizieren durch diese Strategie, wie Studien zeigen.
Der Grund: unerkannte HIV-Infektionen – Menschen, die sich für HIV-negativ halten, tatsächlich jedoch positiv sind, nur bisher nicht von ihrer Infektion wissen. Menschen, die diese Serosorting-Strategie anwenden, tendieren (denkend sie seien ja negativ) mit anderen vermeintlich ‚Negativen‘ zu unsafem Verhalten, wie mehrere Studien z.B. aus Australien und den USA zeigen. Und wenn die Annahmen über den Serostatus eines der Beteiligten sich als falsch erweisen, kann aus der vermeintlichen Schutz-Strategie leicht ein Gefährdungs-Szenario werden.
Serosorting à la „Negativ sucht Negativ für unsafen Sex“- eine Strategie, die sich gerade bei (vermeintlich?) HIV-Negativen als ein äußerst problematischer Weg erweisen könnte …
Über den Einfluss der Therapie
Dass die HIV-Viruslast (neben weiteren Faktoren wie dem Vorhandensein oder Fehlen von ‚Geschlechts- Krankheiten‘) ein wesentlicher Faktor für die Infektiosität ist, ist seit längerem bekannt, ebenso dass eine erfolgreiche Therapie, die die Viruslast deutlich absenkt, damit auch die Infektiosität senkt.
Eine neuere Studie fand, dass erfolgreich antiretroviral behandelte Positive mit niedrigerer Wahrscheinlichkeit HIV übertragen – sowohl im Vergleich mit unbehandelten Positiven als auch mit Positiven, die eine Therapiepause einlegen. Neben der niedrigeren Viruslast wurde als weitere Ursache festgestellt, dass Positive, die eine antiretrovirale Therapie machten oder gemacht hatten, in geringerem Umfang zu sexuell riskanten Praktiken tendierten.
Die Erkenntnis, dass eine erfolgreiche Therapie die Übertragungs- Wahrscheinlichkeit reduziert, ist übrigens nicht so neu – schon 2005 zeigte eine spanische Studie einen deutlichen Therapie-bezogenen Rückgang der HIV-Übertragung zwischen stabilen heterosexuellen Paaren mit unterschiedlichem HIV-Status. Und auch eine ugandische Studie von 2003 (die sich mehr mit dem hohen Infektionsrisiko während der Phase der Primär- Infektion befasste, s.o.) kam zu dem Ergebnis, dass bei Heteros unter einer Viruslast von 1.500 Kopien keine HIV-Übertragung stattfand. Seitdem wird von vielen Forschern davon ausgegangen, dass über einer Viruslast von 1.500 Kopien ein signifikantes HIV-Übertragungsrisiko besteht.
Das Resumé? Im Interview mit der posT 1) antwortet Roger Staub auf die Frage des Interviewers zum Infektionsrisiko „lange unter der Nachweisgrenze, das Risiko können Sie vernachlässigen“ mit „das Risiko besteht wahrscheinlich gar nicht“.
Es geht hier nicht darum, unsafen Sex in welcher Konstellation auch immer zu propagieren, oder gar Reklame für Pillen-Konsum zu machen, oder für einen frühen Therapie-Beginn. Eine antiretrovirale Therapie zu beginnen ist eine wichtige persönliche Entscheidung, die jedem Positiven frei überlassen bleiben muss. Viele Positive wollen oder können keine antiretrovirale Therapie nehmen. Sei es z.B. wegen Problemen mit dem Aufenthaltsstatus oder fehlender Kranken- Versicherung, weil sie angesichts ihres Immunstatus keine Therapie brauchen oder für erforderlich halten, oder auch weil sie generell die Kombitherapie ablehnen. Auch die (aus welchem Grund auch immer getroffene) Entscheidung, keine Therapie zu machen, ist zu respektieren.
Es geht vielmehr darum anhand der Fakten über Infektionsrisiken zu informieren – und nicht einseitig Verantwortung oder gar ‚Schuld‘ (z.B. für vermeintlich deutlich steigende Infektionszahlen) bei Positiven oder Barebackern abzuladen.
Und es geht darum, jedem aufgrund zutreffender Informationen selbst eine freie Entscheidung zu ermöglichen, welche Risiken er eingehen möchte, welche nicht, und in welchen Situationen er sich wie verhalten und schützen möchte.
Schließlich sollten auch Entscheidungen über eine zielgerichtete Weiterentwicklung von Präventions- Maßnahmen zur Stabilisierung und Absenkung der Rate der Neu-Infektionen auf Fakten basiert sein, nicht auf Hysterie oder Propaganda.
1) Roger Staub ist Leiter der Sektion Aids beim schweizerischen Bundesamt für Gesundheit (BAG). Das komplette Interview mit Roger Staub ist zu lesen in der Ausgabe Juli/August 07 der „posT“ (S. 15-24), als pdf hier