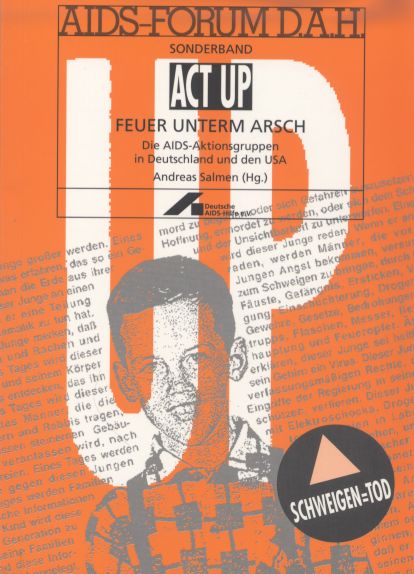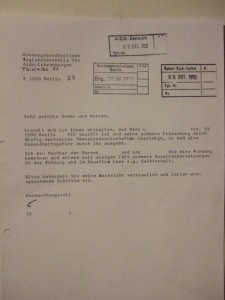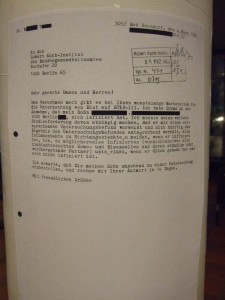1983 wurde die Deutsche Aids-Hilfe (DAH) gegründet. Auf dem 126. Bundesweiten Positiventreffen fand aus Anlass des 25jährigen Jubiläums am 25. Juni 2008 eine Podiumsdiskussion statt unter dem Motto „25 Jahre Deutsche Aids-Hilfe – Geschichte auch für die Gegenwart“
 Auf dem Podium:
Auf dem Podium:
Bernd Aretz – seit 1984 immer wieder und in vielerlei Funktionen Aktiver in Sachen HIV/Aids und deren Institutionen, u.a. Herausgeber Infakt (früher posT), Vorstandsmitglied Aids-Hilfe Offenbach
Claudia Fischer-Czech – 1992 bis 1996 Frauen-Beauftragte, später Frauen-Referentin der Deutschen Aids-Hilfe, danach im Ausland, zeitweise bei ICW (International Community of Women with HIV and Aids); ab 1.7.2008 bei Kassandra (Prostituierten-Selbsthilfe)
Dirk Hetzel – in seinen letzten Tagen als HIV-Referent der Deutschen Aids-Hilfe (DAH)
Carsten Schatz – Landesgeschäftsführer ‚Die Linke‘ Berlin, seit vielen Jahren Mitglied bei positiv e.V. (Veranstalter der Bundesweiten Positiventreffen)
Michael Schumacher – Seit 23 Jahren hauptamtlich im Aidsbereich beschäftigt. 5 Jahre Mitarbeiter in der Bundesgeschäftsstelle der Deutschen Aids-Hilfe (u.a. als HIV-Referent), seit 13 Jahren Geschäftsführer der Aids-Hilfe Köln
Moderation: Prof. Dr. Martin Dannecker – Professor für Sexualwissenschaften, früher Frankfurt am Main, jetzt Berlin
„War Aidshilfe schon von Anfang an gesundheitsbezogene Selbsthilfe? Oder begann sie als Reflex zur Abwehr antischwuler Affekte angesichts der Bedrohung Aids?“ Mit dieser Frage eröffnet Martin Dannecker die Diskussion.
 Die Frankfurter Aidshilfe wurde gegründet von HIV-positiven Männern, die Marburger Aidshilfe hingegen aus politischen Gründen, aus der Befürchtung antischwuler Momente heraus, berichtet Bernd Aretz, der 1984 mit einem positiven Testergebnis nach Frankfurt kam.
Die Frankfurter Aidshilfe wurde gegründet von HIV-positiven Männern, die Marburger Aidshilfe hingegen aus politischen Gründen, aus der Befürchtung antischwuler Momente heraus, berichtet Bernd Aretz, der 1984 mit einem positiven Testergebnis nach Frankfurt kam.
In Marburg z.B. sei die Schwulenbewegung vor Ort nicht begeistert gewesen. Tatsächlich habe es kaum HIV-infizierte gegeben; der HIV-Test sei gegen die politische Strömung angeboten worden. Dieses Spannungsfeld von Selbsthilfe positiver Männer und Abwehr antischwuler Reflexe durchzog Aidshilfe in ihren Anfängen.
Aretz kolportiert zur Illustration eine Begegnung aus dieser Zeit: als er sich als hessischer Delegierter im DAH-Beirat vorstellte mit den Worten „ich bin ein schwuler Mann mit HIV“, habe ihm damals Dieter Runze entgegnet „sowas bespricht man hier nicht“.
 Carsten Schatz wurde 1991 unfreiwillig im Krankenhaus auf HIV getestet. Er engagierte sich schnell bei Pluspunkt, einer aus Patienten der Charité (der sog. ‚Sofarunde‘) hervor gegangenen Gruppe in Berlin Prenzlauer Berg.
Carsten Schatz wurde 1991 unfreiwillig im Krankenhaus auf HIV getestet. Er engagierte sich schnell bei Pluspunkt, einer aus Patienten der Charité (der sog. ‚Sofarunde‘) hervor gegangenen Gruppe in Berlin Prenzlauer Berg.
1992 sei er erstmals auf einer Bundes-Positiven-Versammlung (BPV) gewesen (damals in Hamburg). Er habe schockiert reagiert, als er erleben musste, dass HIV-positive Frauen ihren Platz in Aidshilfe erst gegen Widerstände einfordern, erkämpfen mussten.
Aidshilfe verstehe er als politische Organisation, die dafür einzutreten habe, dass Menschen mit HIV und Aids nicht ‚unter den Teppich gekehrt werden‘.
Dabei gelte es nach vorne zu stellen, was uns verbindet, wofür wir gemeinsam eintreten können.
 Die Braunschweiger Aidshilfe wurde überwiegend von schwulen Männern gegründet, zur Abwehr von Stigmatisierung und Diskriminierung, ‚da gab es damals noch keine Positiven‘, berichtet Claudia Fischer-Czech, damals selbst Gründungs-Mitglied. Sie habe Aidshilfe zu dieser Zeit in Braunschweig als eine sehr solidarische Gemeinschaft empfunden, schnell seien auch Frauen aus den Bereichen Drogengebrauch sowie Prostitution engagiert gewesen. Nach vier Jahren sei sie zu Hydra, einem Prostituiertenprojekt, gewechselt.
Die Braunschweiger Aidshilfe wurde überwiegend von schwulen Männern gegründet, zur Abwehr von Stigmatisierung und Diskriminierung, ‚da gab es damals noch keine Positiven‘, berichtet Claudia Fischer-Czech, damals selbst Gründungs-Mitglied. Sie habe Aidshilfe zu dieser Zeit in Braunschweig als eine sehr solidarische Gemeinschaft empfunden, schnell seien auch Frauen aus den Bereichen Drogengebrauch sowie Prostitution engagiert gewesen. Nach vier Jahren sei sie zu Hydra, einem Prostituiertenprojekt, gewechselt.
Mit ihrem positiven Testergebnis 1992 habe sie zunächst nicht offen umgehen wollen, die Ausschreibung der Stelle als Frauen-Beauftragte der DAH sei mit einem ’nicht ganz freiwilligen Outing‘ verbunden gewesen. Damals hätten sich Frauen im schwulen Kontext der Aidshilfe nicht wohl, nicht gleichberechtigt gefühlt. Ziel sei es gewesen, Frauen überhaupt erst sichtbar zu machen. Auch regional habe es damals begonnen zu ‚brodeln‘, daraus habe sich dann die (schon von Carsten Schatz angesprochene) Hamburger ‚Palast-Revolution‘ ergeben. Im Frauenreferat der DAH habe sie zunächst gegen viele Widerstände arbeiten müssen, vor allem wenn es um Mittel und Eigenständigkeit ging.
 In die Aidshilfe Karlsruhe sei er als junger Mann gekommen, weil dies wohl der Ort gewesen sei, um schwule Männer kennen zu lernen, erzählt Dirk Hetzel. Die Aidshilfe dort sei aus der universitären Schwulenbewegung heraus entstanden, nicht als Gesundheitsbewegung sondern mit dem Moment der Gefahrenabwehr und Antidiskriminierung. Offen positive Menschen habe er damals kaum gekannt, seine erste Begegnung mit einem HIV-Positiven sei Oliver Trautwein gewesen.
In die Aidshilfe Karlsruhe sei er als junger Mann gekommen, weil dies wohl der Ort gewesen sei, um schwule Männer kennen zu lernen, erzählt Dirk Hetzel. Die Aidshilfe dort sei aus der universitären Schwulenbewegung heraus entstanden, nicht als Gesundheitsbewegung sondern mit dem Moment der Gefahrenabwehr und Antidiskriminierung. Offen positive Menschen habe er damals kaum gekannt, seine erste Begegnung mit einem HIV-Positiven sei Oliver Trautwein gewesen.
1989 sei er nach (damals noch West-) Berlin gewechselt, habe als Job im Sommer 1989 bei der DAH im Versand angefangen, später im damals noch vorhandenen Presse-Bereich (Ausschnitt-Dienst). Der damalige Leiter des Referats Psychosoziales, Axel Krause, holte ihn in sein Referat. Krause erkrankte bald schwer, Hetzel war de facto 2 Jahre lang alleiniger Mitarbeiter des Referats, da keine Krankheitsvertretung (außer ihm als junger ‚Aushilfe‘) engagiert wurde. Damals habe es eine große Scham gegeben zu akzeptieren, dass Mitarbeiter erkrankten, für lange Zeit nicht wieder kommen würden – ein heute befremdlich anmutender Umgang mit Krankheit und drohendem Verlust. 1992 habe er seine Festanstellung in der DAH erhalten; 1997 bei einem Krankenhaus-Aufenthalt sein positives Testergebnis.
 In Bonn habe es zwar positive Testergebnisse gegeben (Doktorarbeit Köthemann), im lokalen Schwulenzentrum jedoch keine Positiven, erzählt Michael Schumacher über die damalige Situation.
In Bonn habe es zwar positive Testergebnisse gegeben (Doktorarbeit Köthemann), im lokalen Schwulenzentrum jedoch keine Positiven, erzählt Michael Schumacher über die damalige Situation.
‚Da müssen wir was tun‘, sei der Impuls gewesen, der zur Gründung der Aids-Hilfe Bonn geführt habe. Er sei eines der 7 Gründungsmitglieder der Aids-Hilfe Bonn, die zunächst in den Räumen des Schwulenzentrums angesiedelt war. Dort habe er zunächst ehrenamtlich mitgearbeitet, dann die erste hauptamtliche Stelle erhalten.
Nach 5 Jahren in Bonn habe er dann 5 Jahre in der DAH in Berlin gearbeitet (Schwulenreferat, dann Referent für Menschen mit HIV und Aids), nach einem einjährigen Krankenhaus-Aufenthalt sei er seit nun 13 Jahren Geschäftsführer der Aids-Hilfe Köln. In Köln habe er auch selbst sein positives Testergebnis erhalten.
 „Es gibt eine Phase der Angst vor der politischen Instrumentalisierung dieser Krankheit, primär schwuler Männer – und daraus die Bemühungen, befürchtete Re- Diskriminierungen schwuler Männer abzuwehren. Positive hatten darin keinen richtigen Platz, fast gab es ein Tabu des offen Positiven,“ fragt Martin Dannecker in die Runde, „ist da was dran?“
„Es gibt eine Phase der Angst vor der politischen Instrumentalisierung dieser Krankheit, primär schwuler Männer – und daraus die Bemühungen, befürchtete Re- Diskriminierungen schwuler Männer abzuwehren. Positive hatten darin keinen richtigen Platz, fast gab es ein Tabu des offen Positiven,“ fragt Martin Dannecker in die Runde, „ist da was dran?“
Bernd Aretz erinnert sich an eine Begegnung 1987. Damals habe Ian Schäfer auf einer Tagung der HuK (Homosexuelle und Kirche) gefragt „was können wir für euch tun“. Fragen dieser Art seien damals sogar von Männern gekommen, sie selbst HIV-positiv waren. Sein Ziel sei hingegen immer gewesen zu fragen „was können wir für uns tun“. Auch erinnere er sich an eine Situation bei dem Treffen, an ein deutliches Erschrecken anderer Teilnehmer, als sie feststellen dass es offensichtlich auch Sex mit HIV-Infizierten geben könne.
Auch in Bonn gab es damals keine offen positiven schwulen Männer – sondern offen positiv war Oliver Köppchen, ein Hämophiler, erinnert Michael Schumacher.
„Gab es ein Klima, dass man zwar solidarisch war, aber mit uns nichts zu tun haben wollte?“, fragt Martin Dannecker in die Runde.
„Sag es uns nicht“, sei das damalige Klima gewesen, antwortet ihm Bernd Aretz spontan. Damals sei eindeutig signalisiert worden, ‚ihr seid zumindest vollständig nicht erwünscht‘. Damals seien wohl auch eigene Ängste durch Verschweigen kompensiert worden.
Claudia Fischer-Czech weist auf einen Perspektiv-Wechsel hin. Sie habe sich ja schon „in wissentlicher Zeit“ mit HIV infiziert. Damals habe sich die Wahrnehmung ihrer Person verschoben, eine ‚Degradierung zur Positiven‘ sei eingetreten, der eine Instrumentalisierung gefolgt sei. Sie sei damals Mittel zum Zweck geworden. Zu dieser Zeit sei in Reaktion auf diese Situation das ‚Netzwerk Frauen und Aids‘ gegründet worden. Doch auch dies sei heute von ‚Professionellen‘ durchdrungen, die die Mühen der damaligen Positionierungs-Arbeit nicht mit gemacht hätten, jetzt aber sehr wohl die Chancen nutzten.
 Die Begründung der Bundesweiten Positiventreffen im Jahr 1986 hatte auch damit zu tun, dass sich Positive in Aidshilfen nicht wohl fühlten, erinnert sich Carsten Schatz. Auf einer Tour durch ostdeutsche Aidshilfen sei Michael Schumacher und ihm in einer Aidshilfe ein ‚Posi-Thron‘ gezeigt worden – für den einzigen Positiven, der damals in diese Aidshilfe kam. Genau davor seien die Positiven damals weg gelaufen, „mit Liebe und Zuneigung wurde dir dein Leben entzogen“. Damals sei schon hinzu gekommen, dass er ja auch schon nicht mehr „die jungfräuliche Generation“ gewesen sei. Die Frage „du wusstest doch alles – warum trotzdem?“ habe unausgesprochen oft mit ihm Raum gestanden.
Die Begründung der Bundesweiten Positiventreffen im Jahr 1986 hatte auch damit zu tun, dass sich Positive in Aidshilfen nicht wohl fühlten, erinnert sich Carsten Schatz. Auf einer Tour durch ostdeutsche Aidshilfen sei Michael Schumacher und ihm in einer Aidshilfe ein ‚Posi-Thron‘ gezeigt worden – für den einzigen Positiven, der damals in diese Aidshilfe kam. Genau davor seien die Positiven damals weg gelaufen, „mit Liebe und Zuneigung wurde dir dein Leben entzogen“. Damals sei schon hinzu gekommen, dass er ja auch schon nicht mehr „die jungfräuliche Generation“ gewesen sei. Die Frage „du wusstest doch alles – warum trotzdem?“ habe unausgesprochen oft mit ihm Raum gestanden.
Die jungen Positiven heute infizieren sich alle „beim einzigen unsafen Sex“ ihres Lebens, ergänzt Michael Schumacher, und weist auf das Gefühl hin, man müsse sich in Aidshilfe erklären, rechtfertigen für seine Infektion.
Er habe damals für sich selbst keinerlei Schuldgefühle gegenüber seiner Infektion gehabt, berichtet Dirk Hetzel, wohl aber davor, wie das im professionellen Kontext wahrgenommen werde. Leider hätten genau diese Ängste sich auch als begründet erwiesen. Ein Kollege, der ihn damals bereits seit 10 Jahren kannte, habe in einer Mitarbeiterbesprechung nach seinem Statement reagiert mit den Worten „also das war jetzt die Meinung der beiden Positiven“. Er habe die Reaktion einiger Kollegen damals als ‚Ausgrenzung pur‘ empfunden, sei nicht mehr als Fach-Kollege, sondern nur noch als ‚der Positive‘ wahrgenommen worden.
„Aidshilfe wurde 1985, zu Süßmuths Zeiten, erstmals vom Staat finanziert, übernahm Aufklärungsarbeit, da sie in den ‚Risikogruppen‘ über großes Vertrauen verfügte. Geriet damals die Autonomie in Gefahr? Die Mischung von ’solidarisch‘ und ‚Gesundheitsfürsorge‘ – macht genau die das Problem?“, fragt Martin Dannecker in die Runde.
Dirk Hetzel weist auf die Ambivalenz des Problems hin. Aidshilfe brauche die Neu-Infektionen ja geradezu, sonst gebe es ja zukünftig kein Geld mehr. Dies erkläre implizit auch die immer repressiveren Forderungen aus Politik und Medien – je mehr Normalisierung von HIV/Aids, desto mehr müsse skandalisiert werden, um den betriebenen Aufwand überhaupt noch zu rechtfertigen.
Die Rahmenbedingungen haben sich verändert, bemerkt Michael Schumacher, und wir beteiligen uns zu sehr an einer Verharmlosung der Situation. Dass die Zahlen steigen werden angesichts veränderter Rahmenbedingungen, mit der neuen Freiheit durch erfolgreiche Medikationen, sei geradezu normal. Hier sei Aidshilfe nicht ehrlich. Das müsse auch offen gesagt werden, dem müsse nicht mit Repressionen begegnet werden – und Aidshilfe müsse hier auch Konflikte aushalten, sei derzeit nicht mutig genug.
 Bernd Aretz weist darauf hin, dass in der Anfangszeit keine Alternative zu staatlicher Finanzierung bestanden habe. Eine andere Frage sei, wie dies jetzt aussehe. Er stelle sich die Frage, ob die derzeitige Situation wirklich von einer Zensur seitens BzgA oder Ministerium gekennzeichnet sei – oder es sich nicht vielmehr um eine hausgemachte Krise handele, ein Versagen der eigenen Institutionen?
Bernd Aretz weist darauf hin, dass in der Anfangszeit keine Alternative zu staatlicher Finanzierung bestanden habe. Eine andere Frage sei, wie dies jetzt aussehe. Er stelle sich die Frage, ob die derzeitige Situation wirklich von einer Zensur seitens BzgA oder Ministerium gekennzeichnet sei – oder es sich nicht vielmehr um eine hausgemachte Krise handele, ein Versagen der eigenen Institutionen?
Es hat früher eine Zeit gegeben, in der Positive auch selbst politische Forderungen an die Öffentlichkeit getragen haben, erinnert Carsten Schatz. Heute fehle genau dies, dass Menschen mit HIV und Aids selbst ihre Interessen auf den Tisch legen und einfordern. Die DAH sei artig geworden, artig auch weil es an Druck fehle.
Das sei ein schwieriges Thema, bemerkt Dirk Hetzel, selbst in der Positiven-Community sei politische Meinungsäußerung schwierig, die Solidarität mit einander sei brüchiger geworden.
Dieses „wir“ sei wesentlich verschwommener geworden als in den 90ern, darauf weist Martin Dannecker hin. Heutzutage differenzieren wir zu wenig, führen zu wenig Diskurse. Er fordert, mehr das „wir“ zu reflektieren, deutlicher die unterschiedlichen Stränge aufzunehmen, unterschiedliche Interessen verstehbar zu machen.
Die Positivenbewegung sei doch lange Zeit ein „Verein ich möchte Opfer bleiben e.V.“ gewesen, entgegnet Bernd Aretz. Erst seit zwei, drei Jahren zeichne sich langsam wieder mehr Bewegung ab.
Die Positivenbewegung hat sich mit der Aidshilfe als Präventions-Agentur ’solidarisiert‘, bemerkt Dirk Hetzel. Der integrative Gedanke sei breit akzeptiert – mit der Folge, dass nun ein kritisches Gegenüber fehle, eine kritisch-solidarische Opposition außerhalb der Organisation.
Ein Großteil der Positiven glaubt, Aidshilfe nicht mehr zu brauchen, darauf weist Carsten Schatz hin. Bestimmt Themen -wie den Bereich ‚Aids und Arbeit‚- bearbeite Aidshilfe nicht mehr so, wie Positive es bräuchten. In den Mittelpunkt von Aidshilfe-Arbeit gehörten wieder mehr Themen gestellt, die lebensnah an Positiven-Realitäten orientiert seien.
„Warum bewegen sich Positive nicht? Weil wir in Aidshilfen nur noch als Klienten behandelt werden“, wirft ein Zuhörer ein. „Positive haben keinen Raum mehr in Aidshilfen.“
„Es gibt einen zunehmenden Bruch zwischen Hauptamtlichen und Basisorganisation“, bemerkt ein weiterer Zuhörer, „entweder der Laden wird umgekrempelt und wieder zu einem Sprachrohr der Basis, oder er wird bald zum Sprachrohr des Bundesgesundheitsministeriums.“
 Prävention mit einem realistischen Blick auf die Lebenssituation schwuler Männer, genau da fange der Konflikt an, bemerkt Carsten Schatz. Die Frage sei, wie viel lasse sich Aidshilfe vom Staat vorschreiben, wie viel Selbstbewusstsein habe man noch?
Prävention mit einem realistischen Blick auf die Lebenssituation schwuler Männer, genau da fange der Konflikt an, bemerkt Carsten Schatz. Die Frage sei, wie viel lasse sich Aidshilfe vom Staat vorschreiben, wie viel Selbstbewusstsein habe man noch?
Die Aidshilfen haben Arbeit für den Staat übernommen, und für relativ wenig Geld – und dafür einen verdammt guten Job gemacht, bemerkt Dirk Hetzel.
Man dürfe nicht die Realitäten in Aidshilfen und Selbsthilfen verkennen, wirft ein Zuhörer ein, auch dort gebe es grauenhafte Spießbürgerlichkeiten.
Und eine weit reichende Ent-Solidarisierung, entgegnet ein weiterer Zuhörer, und weist auf Rollbacks z.B. bei Themen wie Spritzen in den Knast oder Prostitution hin.
Ursprünglich autonome Positionen seien aufgegeben worden, darauf weist Martin Dannecker gegen Ende der Veranstaltung hin. Als wie autonom, wie unabhängig vom Staat versteht sich Aidshilfe noch? Es sei offensichtlich – wir brauchen eine offensive inhaltliche Debatte.